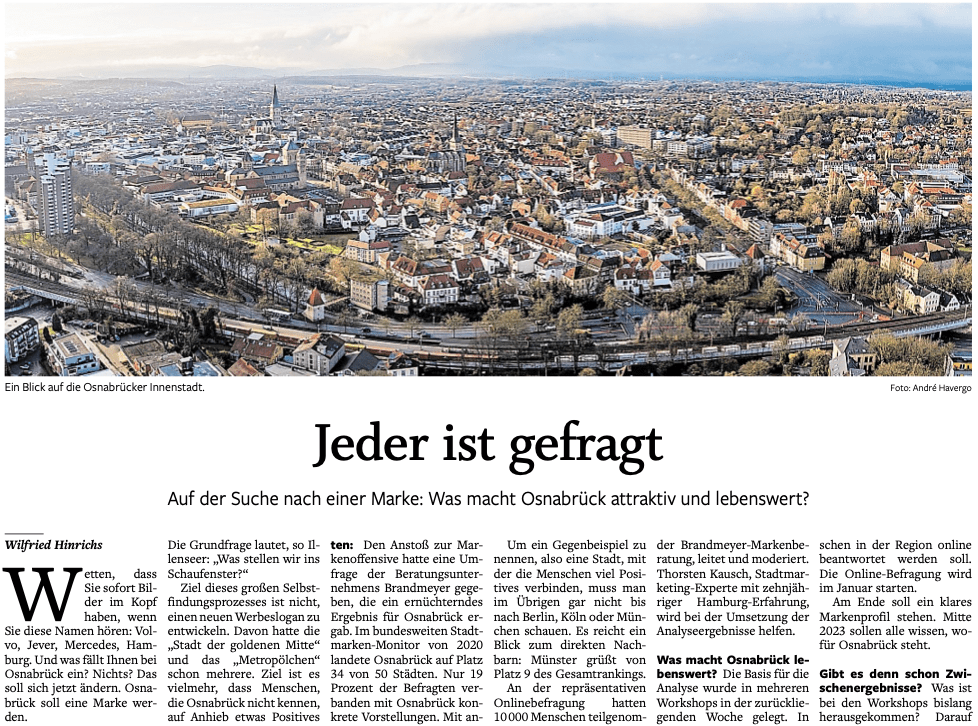Kognitive Dissonanz – menschlich, aber überwindbar?
Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum Menschen oft nicht das tun, was sie eigentlich für richtig halten? Wir finden, man sollte sich mehr für den eigenen Stadtteil engagieren, aber die Einladung zur Bürger:innenbefragung landet ungelesen im Papierkorb. Wir wissen, dass ein sparsamer Umgang mit Energie besser ist, konsumieren aber doch wie gehabt weiter.
Dieser innere Widerspruch zwischen unseren Werten und unserem Handeln nennt sich kognitive Dissonanz. Unser Gehirn liebt Konsistenz und strebt nach einem inneren Gleichgewicht. Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, entsteht ein unangenehmes Spannungsgefühl und der starke Drang, diesen Widerspruch aufzulösen.
Aber was hat das alles mit Bürger:innenbeteiligung zu tun? Unsere kognitive Dissonanz ist oft die unsichtbare Barriere, die uns vom Handeln abhält. Genau hier setzt ein Ansatz aus der Verhaltenspsychologie an: das sogenannte Nudging. Die Idee: Mit sanften Stupsern („Nudges“) wird unsere Umgebung so gestaltet, dass die gute Entscheidung zur einfachsten wird und wir Menschen unser inneres Gleichgewicht wiederherstellen können.
Kurzfassung:
Tom Hartung erklärt das Phänomen der kognitiven Dissonanz als eine Herausforderung in der Entscheidungsfindung von Menschen – und zeigt einen Lösungsansatz: das Nudging. Stadtmacher:innen können diese Methode aus der Verhaltenspsychologie nutzen, um Bürger:innen zum Mitmachen zu motivieren.
Warum gute Vorsätze oft scheitern
Stellen Sie sich vor, ihre Psyche ist eine Tafelwaage: zwei Seiten, die nach Gleichgewicht streben. Ihre Kognitionen sind voneinander abhängig und normalerweise konsistent – zumindest arbeiten Sie unbewusst darauf zu. Wenn allerdings neue Ereignisse oder Informationen Ihren vorhandenen Kognitionen widersprechen, verlieren die Waagschalen das Gleichgewicht. Das übt Druck aus und Sie verspüren das unangenehme Gefühl der kognitiven Dissonanz.
Betrachten wir eine ganz banale Situation. Sie stehen in der U-Bahn-Station vor der Wahl zwischen Treppe und Rolltreppe:
- Auf der einen Seite sind Sie überzeugt: „Treppensteigen ist gesünder, ich sollte mich mehr bewegen.“ (Kognition A)
- Andererseits denken Sie: „Die Rolltreppe ist so viel bequemer und schneller.“ (Kognition B)
In diesem Moment entsteht ein innerer Konflikt. Um diese Spannung aufzulösen, könnten Sie die bequeme Rolltreppe rechtfertigen („Ich hatte einen langen Tag, heute gönne ich mir das.“) oder die normale Treppe abwerten („Die paar Stufen machen den Braten jetzt auch nicht fett.“). Innerhalb von Sekunden hat Ihr Gehirn den Widerspruch aufgelöst und die Waagschalen ins Gleichgewicht gebracht. Sie sind zufrieden, aber dem gesunden Lifestyle entflohen.
Dieses Denkmuster – der Sieg der Bequemlichkeit über den langfristigen Wert Gesundheit – ist harmlos bei der Rolltreppe. Doch genau dasselbe psychologische Phänomen ist am Werk, wenn wir die E-Mail zur Online-Befragung sehen und denken: „Mache ich später.“
Wie Nudges die Spielregeln ändern
Müssen wir also vor unserer eigenen Psychologie kapitulieren? Keineswegs! Wir müssen nur die Spielregeln ändern. Hier kommt das Konzept des Nudgings ins Spiel. Ein Nudge ist ein sanfter Schubser, der die Umgebung so verändert, dass die „bessere“ Wahl zur einfachsten und attraktivsten wird. Der Nobelpreisträger Richard Thaler brachte es auf den Punkt:
„If you want people to do something, make it easy.“
Wenn es um die Aktivierung von Bürger:innen geht, bedeutet das: Stadtmacher:innen können mithilfe von Nudging zu „Entscheidungsarchitekten“ werden, die Prozesse und Wege so gestalten, dass sie intuitiv in die gewünschte Richtung führen. Als sanfte Stupser für mehr Bürger:innenbeteiligung und Engagement für die eigene Stadt.
Das Geheimnis: Nudging zwingt nicht, es lädt ein. Es verbietet nicht, es erleichtert. Es arbeitet mit unserer Psychologie, nicht gegen sie. Und es setzt auf einige Grundprinzipien wie Vereinfachung, Framing und direktes Feedback, die auch aus dem Konzept der Gamification bekannt sind.
Definition: Nudging
Nudging ist die „sanfte“ Gestaltung von Entscheidungssituationen (Choice Architecture), um ein gewünschtes Verhalten wahrscheinlicher zu machen, ohne Optionen zu verbieten oder stark zu verteuern.
Grundprinzipien des Nudgings:
- Voreinstellung: Was voreingestellt ist, wird zur einfachsten Wahl.
- Vereinfachung: Den gewünschten Weg maximal einfach machen (weniger Schritte, kurze Wege, kein Papierkram etc.).
- Timing: Nudges genau dort platzieren, wo entschieden wird.
- Framing: Konkrete und verständliche Botschaften senden; neue Formulierungen finden, die positives Verhalten stärken.
- Soziale Normen: „Die meisten machen X“ als Orientierung und Motivation.
- Feedback: Direktes, simples Feedback (Smileys, Ampel, Countdown) geben.
- Erinnerungen: Kleine Erinnerungen helfen dabei, das gewünschte Verhalten zu etablieren.
- Freiwilligkeit: Entscheidungen freiwillig, transparent, leicht reversibel machen; Wahlfreiheit sichern.
Typisches Beispiel für Nudging in Städten: Sprüche auf Mülleimern (= Nudges) sorgen für Aufmerksamkeit und erinnern an die eigene Verantwortung für eine saubere Stadt
Der Autopilot im Kopf: Warum unser Gehirn Stupser liebt
Um zu verstehen, warum sanfte Stupser so eine große Wirkung haben, müssen wir eine kleine Reise ins Innere unseres Gehirns unternehmen. Der Psychologe Daniel Kahneman hat in seiner Forschung gezeigt, dass wir zwei fundamental unterschiedliche Arten zu denken haben, die er System 1 und System 2 nannte.
System 1 – unser mentaler Autopilot
Stellen Sie sich System 1 als den mentalen Autopiloten vor. Es arbeitet schnell, automatisch, intuitiv und mühelos. Es ist das System, das aktiv ist, wenn Sie ohne nachzudenken eine simple Rechenaufgabe wie „1 plus 1“ lösen, das Gesicht eines Freundes in einer Menschenmenge erkennen oder beim Autofahren auf einer leeren, vertrauten Straße in den vierten Gang schalten.
System 1 ist für den Großteil unserer rund 20.000 Entscheidungen am Tag verantwortlich. Es verlässt sich auf Heuristiken – also mentale Abkürzungen und Faustregeln – um Energie zu sparen. Es ist unser Bauchgefühl, unser erster Impuls. Dieses System ist unglaublich effizient, aber auch anfällig für unbewusste Vorurteile und kognitive Verzerrungen.
System 2 – unser analytischer Co-Pilot
System 2 ist das genaue Gegenteil: Es ist der langsame, analytische, bewusste und anstrengende Denker in uns. Es ist der Co-Pilot, den wir bewusst aktivieren müssen, wenn es schwierig wird. Aufgaben wie „17 mal 24“ sind deutlich komplexer und lassen sich mit System 1 nicht lösen. Auch beim Abwägen der Vor- und Nachteile eines neuen Handyvertrags oder beim Versuch, ein kompliziertes Möbelstück zusammenzubauen, schalten wir auf System 2 um. Es erfordert Konzentration und kognitive Anstrengung.
Da unser Gehirn allerdings von Natur aus energiesparend arbeitet, ist System 2 eher „faul“ und übergibt die Kontrolle so oft wie möglich an den effizienten Autopiloten, System 1.
Nudges nutzen unseren Autopiloten (System 1)
Und genau das ist der entscheidende Punkt: Nudges sind so konzipiert, dass sie direkt auf den Autopiloten (System 1) zielen. Anstatt zu versuchen, uns mit Fakten und langen Argumenten zu überzeugen, verändern Nudges die Umgebung so, dass die bessere Entscheidung für System 1 die einfachste, naheliegendste und attraktivste wird. Ein Nudge sorgt dafür, dass unser Bauchgefühl uns die richtige Richtung lenkt, ohne dass wir groß darüber nachdenken müssen.

Kein Nachdenken notwendig: Nudges können auch im Straßenverkehr für schnelle und sichere Entscheidungen sorgen
Nudging in Städten: Beispiele aus der realen Welt
Viele Städte „stubsen“ ihre Bürger:innen bereits erfolgreich zum gewünschten Verhalten. Typische Beispiele sind:
- Sprüche auf Mülleimern,
- Markierungen im Verkehr („Links stehen, rechts gehen“, „Look left“),
- Countdowns an Ampeln oder
- Ballot Bins zum „Abstimmen“ mit Zigarettenresten.
Ein wirksamer Anwendungsfall sind auch die Geschwindigkeitsanzeigen mit Smileys auf den deutschen Straßen. Wer zu schnell fährt, den blickt ein trauriges, rotes Smiley an. Und es gibt weitere kreative Ideen für Nudging in Städten.
Die Klaviertreppe in Stockholm
Erinnern Sie sich an unser Beispiel mit der Rolltreppe? Genau diesen alltäglichen Konflikt zwischen Gesundheit und Bequemlichkeit hat ein Projekt in Stockholm auf geniale Weise gelöst: Die Stufen einer U-Bahn-Treppe wurden in funktionierende Klaviertasten verwandelt – jeder Schritt machte Musik.
Plötzlich war der Weg des geringsten Widerstands nicht mehr die Rolltreppe. Der Spaß-Faktor der Klaviertreppe dominierte. Ein simpler Nudge mit Gamification, der die Treppennutzung erhöhte.
Grüne Fußspuren in Kopenhagen
Ein ähnliches Prinzip zur Vereinfachung des richtigen Weges steckt hinter einem berühmten Beispiel aus Kopenhagen: Um die Straßen sauberer zu halten, malte man grüne Fußspuren auf die Gehwege, die direkt zu den Mülleimern führten. Dieser auffällige visuelle Hinweis („Salience“) machte die korrekte Entsorgung zur naheliegendsten Handlung. Die Menschen mussten nicht mehr nachdenken, sondern folgten einfach der Spur.
Einladen statt ermahnen: Mit Nudging zu mehr Beteiligung
Ob Online-Umfrage zur Stadtmarke oder Workshop zur Quartiersentwicklung: Das Wissen rund um kognitive Dissonanz und Nudging können wir in der Stadtvermarktung und Stadtentwicklung nutzen, um Bürger:innen die Beteiligung „leichter zu machen“ und sie im Idealfall zu erhöhen.
Am Beispiel einer Online-Umfrage könnte das so aussehen: Wir verlinken in Mails und Plakaten direkt auf eine Umfrage mit maximal drei Fragen, platzieren QR-Codes an Alltagswegen (Haltestelle, Rathaus, Wochenmarkt) und senden Erinnerungen genau dann, wenn Menschen Zeit haben (abends, am Wochenende).
Auf der Beteiligungsseite zeigen wir eine Fortschrittsanzeige („Noch 2 Antworten bis zum Quartiersziel“) plus soziale Norm („Schon 63 Nachbar:innen haben abgestimmt“) und bieten ein Mikro-Commitment an („Ich nehme mir 5 Minuten für meinen Stadtteil“). Nach dem Absenden gibt es sofortiges Feedback („Danke! Ihr Hinweis fließt in Maßnahme X ein“) und eine einfache Option, sich für die nächste Beteiligung vormerken zu lassen.
So reduzieren wir Reibung, rahmen die Aktion positiv, nutzen soziale Signale – und verwandeln kognitive Dissonanz in unkompliziertes Mitmachen.

Nudging im Straßenverkehr: Der Countdown läuft – und macht sichtbar, dass die Ampel bald wieder auf Grün springt
Fazit: Die Kunst, das Richtige einfach zu machen
Das Rätsel, warum wir oft gegen unsere Werte handeln, ist tief in unserer Psyche verankert. Indem wir kognitive Dissonanz als das Problem verstehen und Nudging als Werkzeug nutzen, können wir diesen Weg neu pflastern.
Es geht nicht darum, Menschen auszutricksen, sondern darum, Barrieren abzubauen, die zwischen unseren Kognitionen stehen. Es geht darum, eine Welt zu gestalten, in der unser innerer Kompass und der Weg des geringsten Widerstands in dieselbe Richtung zeigen. Eine Welt, in der es einfach ist, die beste Version unserer selbst zu sein – als Konsument, als Nachbarin und als engagierter Bürger.

Tom Hartung
studiert Wirtschaftspsychologie in Heide. Was ihn fasziniert? Wie Psychologie das Leben in Städten positiv beeinflussen kann. Toms Herz gehört seiner Heimatstadt Fulda.